Absprung aus der Zeitschleife. Barbi Markovićs »Die verschissene Zeit«
Publications | Apr 2025
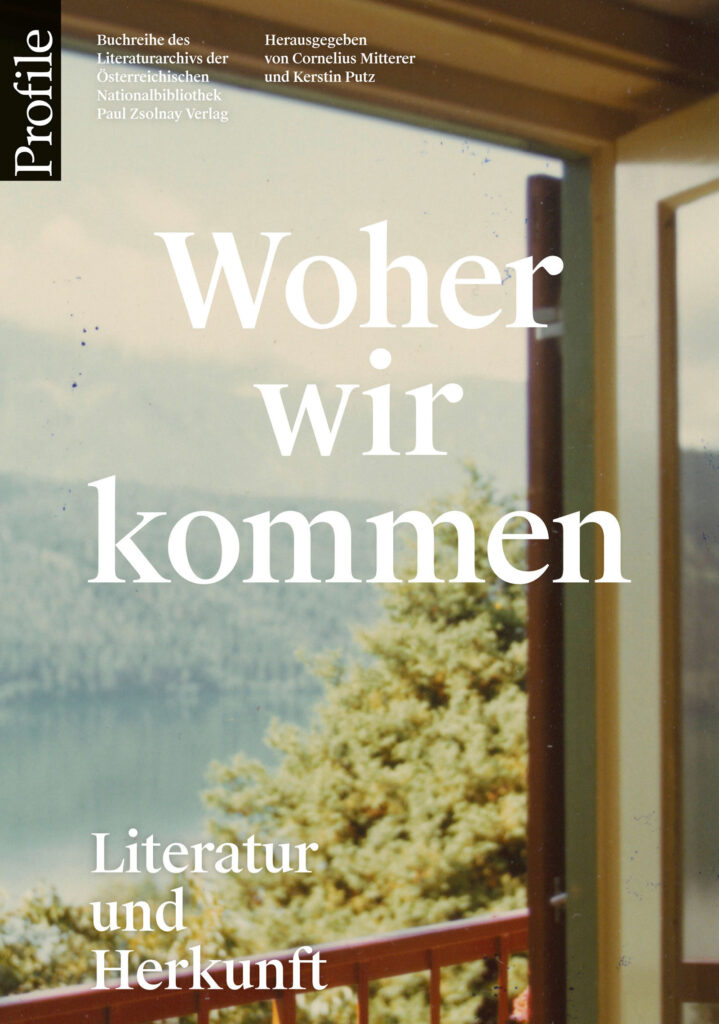
In: Cornelius Mitterer, Kerstin Putz (Hg.): Woher wir kommen. Literatur und Herkunft. Wien: Zsolnay 2025, S. 139–143
Es GEHT tatsächlich NIEMANDEM UM UNS, ABER UNS, UNS GEHT ES EXTREM UM UNS!
(Marković 2021, 216)
Der Ort: Banovo brdo, die Zeit: die »Allneunziger«. In diesem Kontinuum sind die Geschwister Valentina (Vanja) und Marko zusammen mit ihrer Freundin Kasandra unterwegs, um die Vergangenheit umzuschreiben, von dort wollen sie weg. Die »Allneunziger« sind ungewiss und gefährlich, nicht umzubringen und doch hoffnungslos verloren, jedoch nicht so heraufbeschwörenswert wie die Erinnerung in Marcel Prousts monumentalem Buch Auf der Suche nach der verlorenen Zeit (À la recherche du temps perdu, 1913–1927), das Vanja liest, um sich aus der Wirklichkeit auszuklinken. Bevorzugt beim Warten auf den Bus, dessen Ankunft vorauszusagen unmöglich ist – es sei denn, eine:r der Wartenden schickt sich an, eine (schon angerauchte) Zigarette anzuzünden, »dank dieses Rituals kommt sofort ein Bus« (Marković 2021, 126). Es ist die Zeit der Jugoslawienkriege und später der NATO-Bombardierung Belgrads, eine Zeit des Zerfalls, der Auflösung und Gewalt. Für die drei Teenager ist es außerdem eine Zeit keineswegs nur pubertär bedingten Body-Horrors, die sie neben zumeist überforderten, mitunter sadistisch veranlagten Erwachsenen zubringen. Die Eltern kümmern sich um ihre Kinder, was für diese im besseren Fall bedeutet, statt des ersehnten Radios den gleichen Schlafanzug zweimal geschenkt zu bekommen. Die Kinder kümmern sich um kleine Tiere, die sie im Park auflesen und zu ihrer Verantwortung machen, um sie vor dem Massakriertwerden durch größere Tiere und weniger empathiefähige Zeitgenossen zu bewahren.
Banovo brdo, ein Paralleluniversum zum gleichnamigen Belgrader Hügel mit seinen in den 1960er Jahren errichteten Hochhäusern, bildet das Epizentrum von Barbi Markovićs 2021 erschienenem Roman Die verschissene Zeit. Im 12. Stock eines der Häuser wohnen Marko und Vanja. Ihr bevorzugter Lebensraum ist der die Siedlung umgebende, in die Wildnis abbrechende Park. Drinnen wie draußen geht es ums Überleben, wozu es einer Attitüde bedarf, vor allem aber der passenden Kleidung: Markenartikel spielen im Belgrad der 1990er Jahre eine wichtige Rolle. Auf dem Gebiet von Banovo brdo, und also ohne größere Entfernungen zurückzulegen, reisen die Protagonist:innen unfreiwillig zwischen den Jahren 1995, 1999, 1993 und 1996 hin und her: Aufgrund eines technischen Fehlers des (nach dem realen serbischen Robotik-Forscher benannten) Wissenschaftlers Miomir Vukobratović werden sie im »psychowirtschaftlichen Desaster« dieses Jahrzehnts hin- und hergeworfen (Marković/Brandstetter 2021, 4). Miomir will mithilfe einer Zeitmaschine ins Jahr 1968 gelangen, um in die jugoslawische Verfassung einzugreifen und so die politischen Ereignisse der Neunzigerjahre zu verhindern. Zufällig von diesem nostalgiegetriebenen Experiment erfasst, landet das Trio in einer instabilen Zeitschleife, deren Fortdauern Unsterblichkeit verheißen, zugleich aber bedeuten würde, für immer in der »Hölle« der »Allneunziger« leben zu müssen:
»Die moralisch verwahrlosten Grobiane würden mir und Ihnen stets alles wegnehmen. Der Krieg, der in unserem Namen und gegen unseren Willen geführt wird, würde nie wirklich enden. […] Für immer würde Sie der Anblick der einäugigen Katzen und dreibeinigen Hunde auf den Straßen deprimieren. Für immer würden die Stärksten die Schwächsten niedertreten, der Hunger wäre stets in Reichweite. Für immer zuviele Menschen pro Wohnung. Für immer Teenagerleben für Sie und schlechtes Gewissen für mich. Für immer nur Warten und Gewalt.« (Marković 2021, 63)
Wie kann es gelingen, den verhassten Umständen zu entkommen? Um die Zeitmaschine zu reparieren, sollen die Jugendlichen ein geschichtsträchtiges Medaillon finden, von dem es heißt, es besitze »blockfreie Magie«. Eine Magie, die sich als Fiktion entpuppen wird. Realer sind im Jahr 1993 für Vanja, Marko und Kasandra der Krieg und die Nachrichten über ihn (»›Guten Tag, liebe Zuschauer‹, sagt die Moderatorin, ›die Mostar-Brücke ist gestern gesprengt worden‹«), Nationalismus und Inflation (ebd., 138). Selbst die sich nebenher ergebenden Vorteile des Zeitreisens, nämlich im Kleinen etwas in Ordnung bringen zu können, erscheinen düster: Um seinen Vater vor dem Kriegstod im Jahr 1994 zu bewahren, greift Marko am Elternsprechtag zum Hammer und zertrümmert im Werkraum seiner Schule dessen Knie. Die gute Tat ist zugleich Markos Rache für jahrelanges Geprügeltwerden, der Vater vorübergehend außer Gefecht gesetzt: »›Ich werde dich töten‹, ›Du Pferd‹, mehr fällt ihm nicht ein […]« (ebd., 153). Ungleich wortgewandter sind die barock-schillernden Schimpftiraden Kasandras. Für das Mädchen aus der Roma-Siedlung, das von seiner Umgebung regelmäßig daran erinnert wird, »nur eine Zigeunerin« zu sein, werden sie zum Medium der Selbstermächtigung (ebd., 119): »›Tut mir leid, ich könnte ihn schlachten, wenn er so überheblich daherkommt.‹ Mit ›schlachten‹ meint sie nicht wirklich schlachten. Es ist ein ganz normales Wort. Die Mütter sagen es zu ihren Kindern, wenn sie ihre Hausaufgaben nicht machen oder ihr Zimmer schmutzig ist. ›Ich schlachte dich, wenn du wieder einen Dreier bekommst […]‹. Aber interessant ist eigentlich, wie so ein Wort sich in seiner unschuldigen Version in euren Leben verbreitet, während ein paar hundert Kilometer weiter Menschen am tatsächlichen Schlachten beteiligt sind.« (Ebd., 78f.)
Dass Markovićs aus einem Rollenspiel entwickelter (und ein solches mitliefernder) Roman bei aller Tristesse grandios komisch ist, verdankt sich nicht zuletzt der Lust an übersetzungsbedingten Bedeutungsverschiebungen, von Splatter-Ästhetiken inspirierten Bildern burlesker Gewalt sowie der Rasanz körperlichen Außer-sich-Geratens und – wenigstens im Spiel – unverwundbaren Weitermachen-Könnens. Die erzählte Zeit hingegen hält Vanja, Marko und Kasandra wie eine klebrige Masse am Platz: »In der Verschissenen Zeit ist so wenig möglich, dass euch jeder Scheiß magisch vorkommt.« (Marković/Brandstetter 2021, 6) Unter dem Einfluss von Tramadol erscheint ihnen der Frühling noch schöner, immer wieder neu müssen die Zeitreisenden sich in ihren jüngeren oder älteren Körpern zurechtfinden: »Spätestens mit 16 würdest du eine strahlende, goldene Schönheit werden mit Haaren, die im Wind flattern […], aber stattdessen bist du in einem Zimmer aufgewacht, das du nicht erkennst, und hast Akne […]« (ebd., 26). Als wäre für die sich – dank Zeitsprung – im Jahr 1999 mit dem Bewusstsein einer Dreizehnjährigen wiederfindende Vanja Dimić die Aussicht auf einen unmittelbar bevorstehenden Schwangerschaftsabbruch nicht genug.
Die verschissene Zeit ist ein polyphones Erinnerungsprojekt, das seine eigene Genese und die Frage nach der Deutungshoheit über Geschichte reflektiert. Wer darf sie erzählen? Wer kann sie hinter sich lassen? Das Format des Rollenspiels dient der Autorin dabei als »Mechanismus […], um mich sinnvoll zu erinnern, wenn ich einen Roman über diese schreckliche, interessante Zeit schreiben will« (Marković 2025). Die Erinnerung, ebenso wie aus ihr gemachte Geschichte, ist unwägbar, unsicher, oftmals falsch – und hart umkämpft: »manche eurer Eltern und eurer Freunde werden ihre Leben im (erweiterten) Kampf um die gültigen Erinnerungen verlieren« (Marković 2021, 116). Und sie duftet nicht unbedingt nach Tee und Madeleines, wie in der berühmten Episode in Prousts Recherche, deren Erzähler vom Geschmack eines der muschelförmigen Sandküchlein in seine Kindheit zurückversetzt wird. Eine solche unwillkürliche Erinnerungssensation, von Proust als mémoire involontaire von der mémoire volontaire, dem »intellektuelle[n] Erinnern« unterschieden (Proust 1997, 62), ereilt in Form einer Persiflage dieser Szene bereits die Ich-Erzählerin in Markovićs Roman Superheldinnen (2016): Diese wird nicht beim Teetrinken, sondern auf einem Balkon durch den Geruch trockenen Vogelkots »unvermittelt zurück in eine andere Zeit [katapultiert]« (Marković 2016, 144).
Den Protagonist:innen der Verschissenen Zeit gelingt es schließlich, die Zeitmaschine zu kapern und den »Allneunzigern« zu entkommen: »Unter euch wird Banovo brdo flach. Die ganzen dünnen Gestalten mit schwarzen Augenringen werden immer kleiner und weniger erkennbar, und schließlich verschwinden sie und werden von Straßen verschluckt. […] Vielleicht werden eines Tages alle so abheben können wir ihr, eine gesunde Distanz zu den 90ern entwickeln.« (Marković 2021, 224) Doch das ist nicht das Ende der Geschichte. Vanja erwacht im Jahr 2001 auf dem Belgrader Platz der Republik inmitten der ersten, von einem Mob erfolgreich verhinderten Gay Pride der Stadt. Neben ihr auf dem Boden liegt ein junger Mann im Batik-Shirt, sein Gesicht blutig geprügelt. »Auf der Straße brüllen die Männer noch rhythmisch: ›TÖTE DEN SCHWULEN, TÖTE, TÖTE, TÖTE DEN SCHWULEN‹ […]« (ebd., 226).
Die Zukunft erscheint zunächst um nichts besser als die Vergangenheit. Den Ort und die Umstände ihrer Kindheit endgültig hinter sich zu lassen, und also zu vergessen, gelingt Vanja letztlich nicht ohne die Anstrengung, selbst eine andere zu werden. Aufzubrechen heißt in Die verschissene Zeit auch: »Stück für Stück die Vergangenheit anschauen und sie überschreiben. Szene für Szene, Bild für Bild, bis alles so oft in verschiedenen Lichtern ausgeleuchtet wurde, dass die Traumata keinen Nährboden mehr bekommen. Gehe zurück, erinnere dich exzessiv […]« (ebd., 229).
Katharina Manojlovic
LITERATUR
Marković 2016 = Barbi Marković: Superheldinnen. Roman. Salzburg, Wien: Residenz 2016.
Marković 2021 = Barbi Marković: Die verschissene Zeit. Roman. Salzburg, Wien: Residenz 2021.
Marković 2025 = Barbi Marković: Stehlen, Schimpfen, Spielen. Unveröffentlichtes Manuskript (erscheint im Mai 2025 im Rowohlt Verlag).
Marković/Brandstetter 2021 = Barbi Marković, Thomas Brandstetter: Die verschissene Zeit. Das Rollenspiel. Salzburg, Wien: Residenz 2021 (Beilage zum Roman).
Proust 1997 = Marcel Proust: In Swanns Welt. Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Erster Teil. Aus dem Französischen v. Eva Rechel-Mertens. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag 1997.